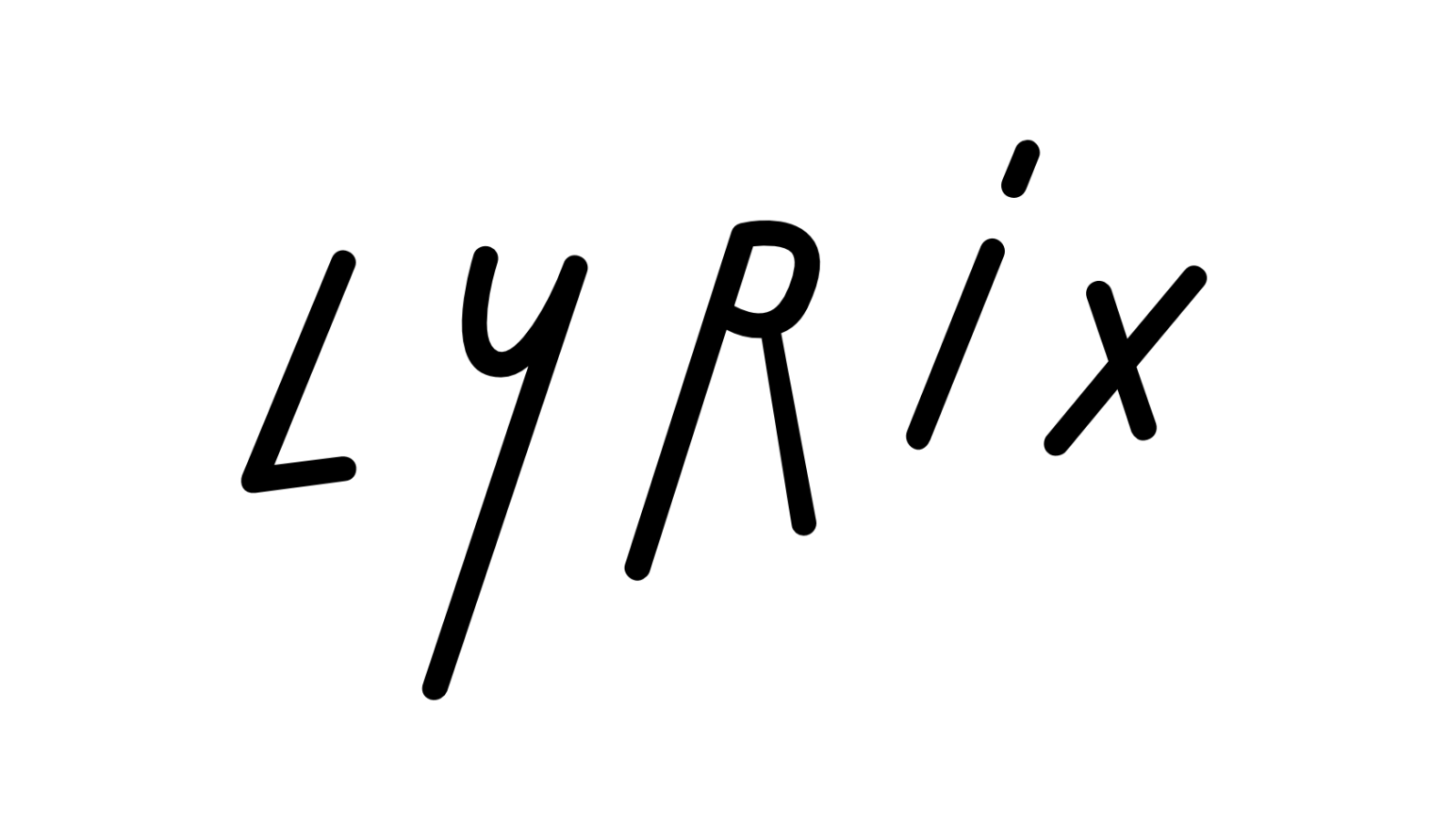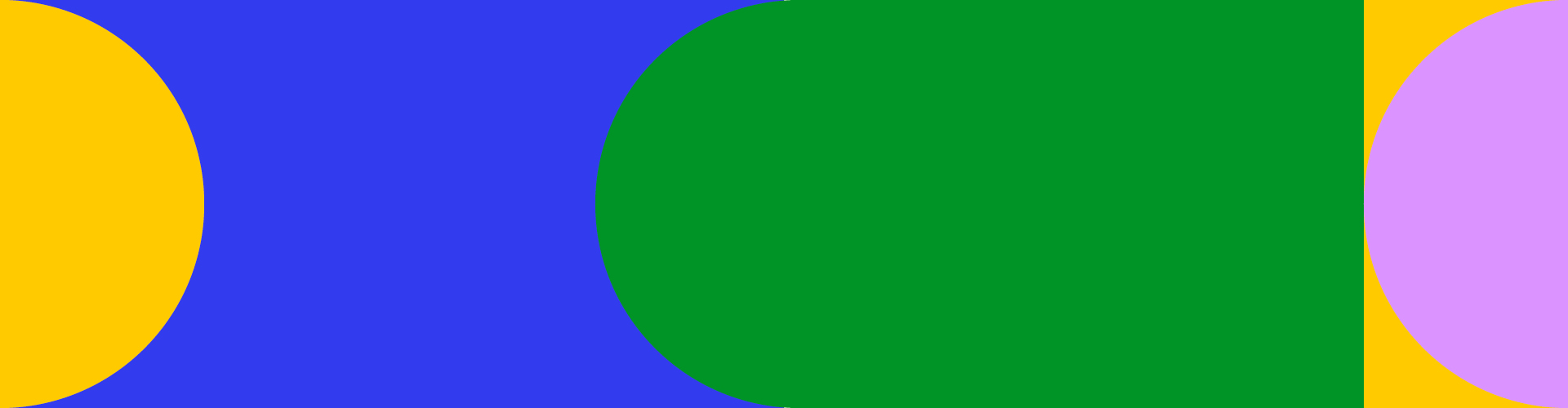Jetzt musst du springen - Teil I
Lesen – Sprechen – Durchhalten. Ein Essay der ehemaligen lyrix-Preisträgerin Josefine Berkholz über das Lesen und das Schreiben, über das Finden einer (eigenen) Sprache und über das Dichten für sich selbst und für die Öffentlichkeit.
von Josefine Berkholz
Teil I
1: EVERY SONG’S A LOVESONG // LESEN
Der Nachteil bei großer Literatur ist,
dass jedes Arschloch sich damit identifizieren kann.
Peter Handke
Ich weiß noch, wie ich das erste Mal Beziehungsprobleme hatte, weil ich dachte, Joan Didion wäre die einzige, die mich wirklich versteht. (Es ist noch nicht so lange her.)
In ihrem Essay “Good Bye to All That” schreibt sie: It is easy to see the beginnings of things, and harder to see the ends. I can remember now, with a clarity that makes the nerves in the back of my neck constrict, when New York began for me, but I cannot lay my finger upon the moment it ended, can never cut through the ambiguities and second starts and broken resolves to the exact place on the page where the heroine is no longer as optimistic as she once was.

Ich saß in einem ruckelnden Flixbus auf dem Weg zu meinem ersten Freund, mir war ein bisschen schlecht, weil ich im Bus nicht gut lesen kann, wir verließen ein vernieselregnetes Leipzig Ost, ich hatte die Beine gegen die Lehne meines Vordersitzes gefaltet, dass sie schon vor der Autobahn anfingen zu kribbeln und dachte, dass man das alles doch vollkommen vergessen könne.
Die Autorin wusste scheinbar genau, was mit mir los war. Was hieß: es war möglich. Was hieß: niemand sonst wusste es (niemand!), sonst wäre mir das ja aufgefallen, sonst hätte ich mich vorher schonmal so gleichzeitig ertappt und aufgehoben gefühlt, dass es einen ganz wund macht, und daran würde ich mich ja wohl erinnern.
Natürlich hätte ich versuchen können, dem armen, liebevollen Jungen am anderen Ende der A38 dieses Gefühl zu erklären, aber wie um alles in der Welt sollte das gehen, ich verstand es ja selber nicht, und vor allem: ich hatte keine verdammte Sprache dafür. War also nicht der Junge schuld. Joan hatte sie scheinbar, aber Joan war Amerikanerin und uralt und kannte mich nicht und hätte mich wahrscheinlich ein bisschen bemitleidenswert gefunden. Und überhaupt: vermutlich versagte da einfach die Sprache, vermutlich kannte man sich entweder oder man kannte sich eben nicht, und meistens kannte man sich eben nicht.¹
Didion schreibt im gleichen Essay an anderer Stelle: one of the mixed blessings of being twenty and twenty-one and even twenty-three is the conviction that nothing like this, all evidence notwithstanding, has ever happened to anyone before. Ich war zwanzig und fühlte mich ertappt und war froh darüber, weil das eventuell bedeutete, dass es irgendwann besser würde. Es wurde in der Tat ein bisschen besser, ich bin seit drei Monaten vierundzwanzig und das bedeutet wohl, ich bin aus dem Gröbsten raus. Ich übernehme allerdings keine Garantien, weder für mich noch für euch.
Inzwischen lasse ich die Leute, die ich am meisten liebe, meine Gedichte lesen und hoffe auf das, was man selber beim Schreiben nicht ganz begreift, und auf die Lesekompetenz meiner Freunde. Manchmal klappt es, und es ist schön, sich getraut zu haben.
Wahrscheinlich kennt jeder und jede, die es ernst meint mit dem Lesen, das Gefühl, sich in einer Textstelle ganz genau wiederzufinden. Man kann daraus den Schluss ziehen, sofort seinen Freund zu verlassen oder den, dass es halt wenigstens in den Büchern Hoffnung gibt, oder den, dass das Alleinstellungsmerkmal toter (oder uralter) Schriftstellerinnen vielleicht nicht das Verstehen ist, sondern die Sprachfähigkeit. Jedenfalls ist das wie ein Einschlag: Dieses Gefühl ist beschreibbar. Und noch mehr: ich bin nicht die Einzige, die es hat.
Dass man damit in dem Sinne auch vollkommen falsch liegen kann, dass die Autorin das vielleicht gar nicht „meinte“, dass da eventuell an eine Erfahrung gedacht wurde, die sich von meiner unterscheidet, ist unerheblich. Es geht nicht um erfahrungstechnische Deckungsgleichheit oder darum zu erraten, was sich ein Autor gedacht hat. Es geht darum, dass mir eine Sprache gegeben wurde. Ich habe sie dann. Das ist ungeheuerlich und tut sehr, sehr gut. Wenn du dich also das nächste Mal fragst, ob Gedichte irgendeine Relevanz haben: Ja. Haben sie.
Im Märchen (Rumpelstilzchen) und im Horrorfilm (The Conjuring) werden Dämonen und anderweitige Schreckgestalten dadurch gebannt, dass man sie bei ihrem Namen nennt. Den muss man dafür natürlich erstmal kennen. Eine Sache benennen zu können bedeutet also in gewisser Weise, Macht über sie zu haben. Das gilt bei weitem nicht nur für die sichtbaren Monster der Filmgeschichte. Sich auf den Namen einer Sache einigen zu können, bedeutet die Möglichkeit einer gemeinsamen Erfahrung. Und dafür muss die Autorin nicht mal wissen, dass es mich gibt. Sie hat durch ihre Sprache meine Erfahrung gebannt, und das bedeutet die Möglichkeit einer Sprache und wohl gleichzeitig die Möglichkeit von Verstehen. Andere können es auch sehen. Ich bin nicht verrückt. Oder ich bin es, denn was soll das überhaupt heißen, aber ich bin es jedenfalls nicht alleine.
Das Gefühl zu haben ein Gedicht zu verstehen, oder, vielleicht trifft es das viel eher: von einem Gedicht verstanden zu werden, bedeutet die Hoffnung, dass Kommunikation möglich ist. Vielleicht nicht so geradlinig und effizient wie wir es im Alltag von ihr erwarten. Vielleicht aber dadurch umso tiefer. Das ist bisweilen unerträglich tröstlich.
Fortsetzung folgt…
¹Julie: Du kennst mich, Danton.
Danton: Ja, was man so kennen heißt. Du hast dunkle Augen und lockiges Haar und einen feinen Teint und sagst immer zu mir: Lieber Georg! Aber (er deutet ihr auf Stirn und Augen) da, da, was liegt hinter dem?
Geh, wir haben grobe Sinne. Einander kennen?
Wir müssten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken uns aus den Hirnfasern zerren.
Noch so eine Stelle. (Georg Büchner, Dantons Tod, I.1, V. 12-18)
Josefine Berkholz wurde 1994 in Durham, North Carolina geboren und lebt in Bochum. Sie schreibt Lyrik, Dramatik, Performatives und Nonfiction.
In den letzten Jahren viel Kollektivarbeit, meistens in spartenübergreifenden Projekten, als letztes das Theaterstück „Die Armstronggrenze“ (mit Thomas Kaschel, Schauspieler und Tristan Berger, Producer&Komponist) und das Spokenword/Rap/Musik-Projekt „Betroit“ (mit Künstler*innen aus Detroit und Berlin).

Seit 2010 fester Bestandteil der deutschsprachigen Poetry Slam Szene, Auftritte in Russland, Brasilien, den USA und Kenia und in deutschen Käffern, Texte u.a. beim 21. Treffen junger Autoren, bei 4+1 – Ein Treffen junger AutorInnen, in Zeitschriften und in Anthologien. 2013-2017 Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.